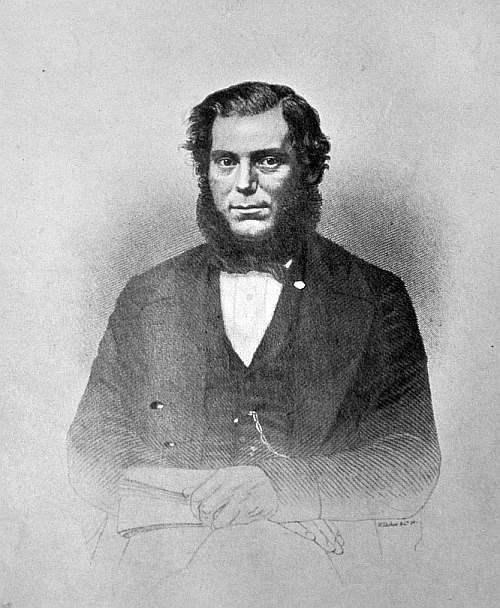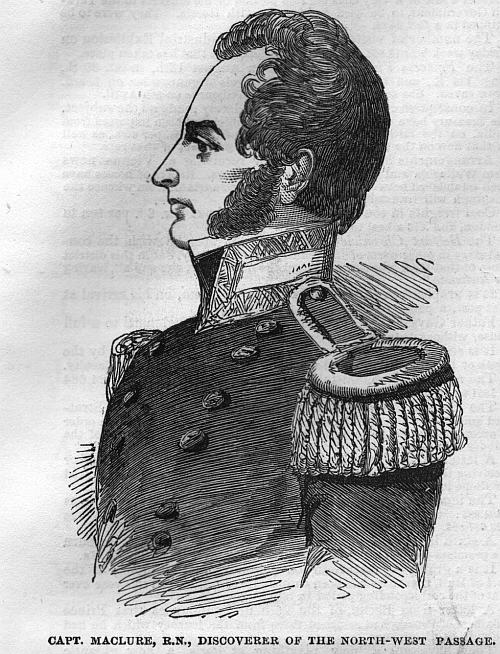reblogged vom 31. Januar 2013
Unerwarteter Vulkanausbruch auf Kamtschatka am 27.11.2012

Einige Monate vor dem Spaltenausbruch am Ploski Tolbatschik („flacher Tolbatschik“) verbrachten wir im September mit einer kleinen Reisegruppe aus Schweizern und Deutschen drei interessante Tage zwischen den schwarzen und roten Aschekegeln, die sich bis zum Horizont hinziehen.

Ein Teil der Gruppe hatte „Holzklasse“ gebucht; die etwas härter Gesottenen zelteten direkt auf dem körnigen Ascheboden, der mit seinen vielen Hohlkörpern wie eine Isomatte wirkt. „Holzklasse“ bedeutete, dass Einheimische in den letzten Jahren hier kleine Holzhäuser gebaut hatten, als Unterkünfte mit der Möglichkeit, an langen Tischen gemeinsam Essen einzunehmen. Ein großer Vorteil gegenüber der Situation, wenn Küchenzelte aufgebaut werden müssen, die durch Wind und Sturm gebeutelt werden und oft die Zerreißprobe nicht bestehen.

Dieses Fleckchen Erde nannten die Russen „Leningradstation“, denn Wissenschaftler aus Leningrad hatten hier einst ihr Mondmobil „Lunochod“ getestet. 1991 hatten wir das große Glück, dieses Fahrzeug noch zu sehen – voller Stolz wurde es uns vorgeführt. Mit der Abschaffung des Sozialismus und der Wandlung in ein neues, altes Russland war das erledigt. Fehlende Gelder ließen sowohl dieses Objekt als auch das ganze Mondprojekt sterben, aber die Holzhütten blieben erhalten – bis zum November 2012.
Nach dem Ausbruch des Vulkans am 27. November flog eine Unmenge Asche und eine Art glühender Regen auf die Häuser. Sie gehörten zum ersten, was der Lavastrom verschlang, wie auch die unterirdischen Zieselbaue, deren Bewohner mitten im Winterschlaf für immer in der Hitze verschmorten, genau wie all die Insekten, die dort überwinterten. Zweibeinige Einwohner kamen nicht zu Schaden, weil die nächste Siedlung Kosyrewsk etwa 30 Kilometer entfernt liegt – sie konnten das beeindruckende Spektakel von dort aus beobachteten.

Im Sommer war uns der Aufstieg zum Ploski Tolbatschik verwehrt geblieben. Regen, der in Schnee überging, machte den Abbruch des Vorhabens nötig. Das war ungefähr an der Stelle, wo jetzt glühende Lava bis zwanzig Kilometer lang zähflüssig und brüllend in die Schneelandschaft fließt und Wasserdampf, mit Asche vermischt, in den Himmel steigt.
Wir hatten am nächsten Tag die Dykes am Ostrij Tolbatschik („Spitzer Tolbatschik“) besucht. Das sind Lavaschlote, die einst schnell nach oben stießen und dann zu einer in den Himmel ragende Säule erstarrten. Über tausende Jahre haben Regen, Schnee und Wind den Basalt geschliffen. Nicht weit davon, taleinwärts an einem reißenden Bach, liegt eine alte Beobachtungshütte, die während des Vulkan-Ausbruches 1975/1976 erbaut wurde. Von dort aus konnte man aus sicherer Position den Ausbruch des nördlichen und südlichen Konus vom Tolbatschik beobachten. Nun wird auch diese Hütte mit ihrer Geschichte von Asche bedeckt, und erst im nächsten Sommer zeigt sich, ob sie wieder genutzt werden kann.

Mit denjenigen, die noch nicht genug vom Tage hatten, wanderten wir damals am Abend nach oben zu einem großen roten Aschekegel, der in der untergehenden Sonne glühte. Eisige Stürme kamen uns entgegen, aber die Aussicht – die war „bilderreif“!!! In Richtung Süden sahen wir den Kizimen, und unsere Herzen schlugen höher. Ich sagte: „Schaut mal – der raucht“, denn am blauen Horizont sah man den Ascherauch aufsteigen.
Wir kamen nicht aus dem Staunen heraus. „Jetzt fehlt bloß noch der Tolbatschik-Ausbruch“ lästerte ich sorglos dahin. Um so erstaunter war ich, als Ende November E-Mails aus Petropavlovsk erhielt. Mein Freund Viktor Okrugin übersandte mir gleich aktuelle Fotos, die er vom Hubschrauber aufgenommen hat und ich hier veröffentlichen darf. Viele Freunde in Deutschland riefen mich an: „Ulli, Vulkanausbruch, warum sind wir nicht dort?“ Tja…

Derzeit [ Januar 2013] rauchen auf Kamtschatka vier Vulkane, die sich alle in einer Bruchlinie befinden. Die schwere pazifische Ozeanplatte südlich der Aleuteninselkette rutscht unter die Eurasische Festlandsplatte, und die ozeanische Platte des Beringmeeres oberhalb der Aleuten ist auch in Bewegung, so dass verschiedene Drücke und Kräfte auf die Vulkane im zentralen Teil Kamtschatka einwirken.

Das betrifft die große Vulkanruine Schivelutsch (3307m), die auf der anderen Seite, nördlich des Kamtschatkaflusses liegt, und den „kleinen“ Besimjany (2869m) am südlichen Fuße des Kameny (4579m) und Klutschewskaya (4688m), der nördlich des Tolbatschiks seine Rauchfahne zeigt. Dazu kommen der Spaltenausbruch des Ploski Tolbatschiks (3062m), der jetzt am aktivsten ist, und der Kizimen (2375m), dessen leichte Ascherauchfahne hochsteigt – im Satellitenbild gut erkennbar.
Auf dieser Linie liegen noch mehrere aktive Vulkane, und man ist vor Überraschung nicht gefeit…


reblogged vom 31. Januar 2013 von Ullrich Wannhoff